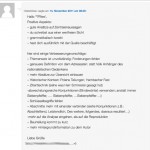Da eine Referendarin in Kürze meinen Unterricht übernehmen wird und ich sie gut beraten möchte, habe ich mir nach längerer Zeit mal wieder meine gute alte Deutsch-Didaktik aus dem Schrank gezogen. Und wie das beim Stöbern oft so ist, stößt man währenddessen auf ganz andere Dinge.
So begegnete mir zum ersten Mal im Kontext des Satzbaus die Idee, das Verb nicht prototypisch von seiner Position an der zweiten Stelle im Hauptsatz aus zu denken (und zu unterrichten), sondern eher den anderen Fall, die Klammerstruktur, als den Normfall zu betrachten. Das scheint mit einigen Problemen aufzuräumen, aber langsam. Zunächst ein Beispiel für die typische Vorgehensweise (hier dem Deutschbuch 5, Auflage 2011, von Cornelsen entnommen):
Der Kern des Satzes ist das Prädikat (Satzaussage). Prädikate werden durch Verben gebildet. In einem Aussagesatz steht die Personalform des Verbs immer an zweiter Satzgliedstelle:
Oft zeichnen Piraten eine Schatzkarte. So finden sie später ihre Beute.
(DB 5, S.255, Hervorhebungen im Original)
Das ist leicht zu merken, trifft aber leider nur auf manche Sätze zu. Sobald man sich komplexerer Satzstrukturen oder Zeitformen bedient, die eine Klammerstruktur erfordern, ist es schnell hinüber mit der leicht verständlichen Zweitposition des Verbs [1. Das Deutschbuch scheint sich dessen bewusst, denn es verweist gleich im Nachsatz darauf.]:
Die vermeintliche Zweitposition
Die Zweitposition ist nämlich nicht unbedingt der Regelfall:
Wenn man das bspw. das Perfekt verwendet, muss man auf eine Klammerstruktur zurückgreifen:
Es ist auf einen Sieg der Arminia hinausgelaufen.
Auch in einfachen Zeitformen muss geklammert werden, wenn man trennbare Verbformen verwendet:
Es lief auf einen Sieg der Arminia Bielefeld hinaus.
Der Gebrauch von Modalverben leistet ebenfalls der Klammerstruktur Vorschub:
Es sollte auf einen Sieg der Arminia Bielefeld hinaus- laufen.
Erklärt man Schüler*innen erst im Nachhinein die Prädikatsklammer, so können sie durchaus noch nachvollziehen, dass auch hier das flektierbare Verb an zweiter Stelle steht, jedoch fällt es vielen sichtlich schwerer, eine Klammer als solche überhaupt zu erkennen.
Völlig verwirrend ist die Regel mit der Zweitposition dann, wenn vorangestellte Nebensätze ins Spiel kommen:
Weil XY so laufstark agierte, lief es auf einen Sieg der Arminia hinaus.
Das flektierbare Verb befindet sich nun gar an der ersten Position im Hauptsatz. Ich gebe meinen Schüler*innen darum immer den Hinweis, dass das flektierbare Verb im Hauptsatz immer vorne steht.
Die Klammer als der Regelfall
In meiner alten Didaktik [2. Deutsch Didaktik. Leitfaden für die Sekundarstufe I und II, Berlin 2003] plädiert Angelika Steets unter Bezug auf Eduard Haueis darum dafür, „die Satz- oder Verbklammer als Regelfall und nicht als Sonderfall zu betrachten“ (S.221). Bei einteiligen Verbformen solle der rechte Rand der Klammer dann als „nicht sichtbar besetzt“ (ebd.) betrachtet werden. Zur Klammer gehören dann auch die Konjunktionen oder andere einleitende Ausdrücke wie „(…) weil XY so laufstark agierte.“
Vorteile dieser Betrachtung seien,
- dass die Prädikatsklammer nicht später erneut eingeführt werden müsse.
- dass diverse Möglichkeiten zur sprachreflexiven Auseinandersetzung gegeben seien (Wie funktioniert der Spannungsaufbau innerhalb der Klammer? Wieviele Informationen lassen sich sinnvoll im Mittelfeld der Klammer einsetzen? Welche Möglichkeiten zur Entlastung der Klammer gibt es? Etc.).
Lohnenswert?
Ich finde, dass das durchaus lohnenswert klingt. Fraglich bleibt für mich, ob man Kinder im Alter zwischen 10 und 12 Jahren mit abstrakten Strukturmodellen „abholen“ kann.
Habt ihr das schon mal ausprobiert? Wie geht ihr da vor?
_____