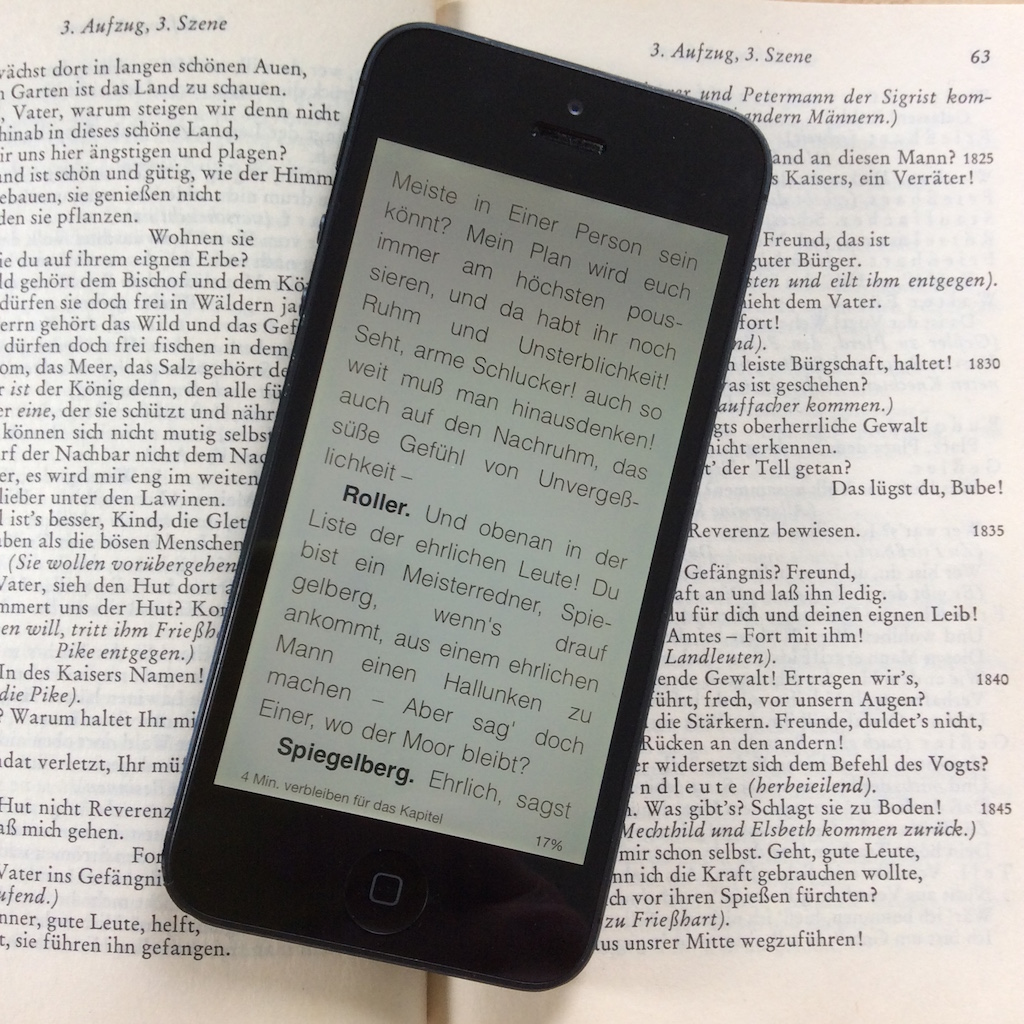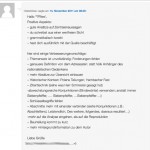Dieser Beitrag wurde inspiriert durch eine Twitter-Debatte, bei der mir einmal mehr deutlich wurde, dass man auf Twitter nicht debattieren kann. Ich habe ich mich darum aus der Debatte zurückgezogen und beschlossen, meine Gedanken hier zu verbloggen.
Es begann alles mit folgendem Tweet:
@Hokeys @adenauerhut Foto machen und den SuS in die WhatsApp-Gruppe schicken 😉
— Peter Jochum (@JochumPeter) 19. März 2017
Ich antwortete negativ, da ich die konkrete Unterrichtssituation eine Einstieges vor Augen hatte, bei dem etwas per Schere ausgeschnitten werden sollte. Das wäre mit einer WhatsApp-Nachricht schlicht nicht möglich gewesen. Dieser Mangel an Information war jedoch kein Grund, nicht polemisch über mein uncooles Nichts-WhatsApp-Einsetzen herzuziehen. Der Verweis darauf, dass überdies nicht alle Kinder der besagten Klasse ein Handy besitzen, wurde mit Verweisen auf Statistiken abgeschmettert („Alle Kinder haben ein Handy!“). Zu guter Letzt ist an meiner Schule die schulische Nutzung sozialer Netzwerke ausdrücklich (und ich meine damit ausdrücklich) untersagt, aber, so im Twitter-Stream: „Wer nicht will, findet Gründe“.
WhatsApp nicht zu nutzen sei ignorant, der Ausgangstweet Gejammer obendrein, jedes Kind habe ein Handy, schließlich müssten die Kinder den Umgang damit auch lernen, und das Mobbing verlagere sich sowieso anderswo hin.
Irgendwann hatte ich dann die Schnauze voll und habe beschlossen, das Thema lieber zu bebloggen, denn eine ernsthafte Auseinandersetzung war leider nicht möglich. Nun denn, hier kommt meine Perspektive.
Meine persönliche Haltung zu WhatsApp
Ich bin kein Freund von WhatsApp und nutze es nur, wenn mein Kontakt keine adäquate Alternative nutzt. Ich habe dem Facebook-Kosmos den Rücken gekehrt (Facebook- und Instagram-Account gelöscht) und würde lieber heute als morgen WhatsApp den Rücken kehren, weil ich mich nicht freiwillig der Datensammelwut von Facebook hingeben möchte. Es gibt allerdings leider Menschen, zu denen ich nur per WhatsApp Kontakt halten kann. Kinder dazu zu bringen, eine Software zu nutzen, die ich selbst nicht nutzen möchte, halte ich für widersprüchlich.
Ein weiterer Aspekt ist die permanente Erreichbarkeit. Ich versuche, sehr bewusst mit meiner Zeit umzugehen und habe konkrete Zeiten, in denen ich nicht erreichbar bin. Für ca. 120 bis 180 Schüler permanent per WhatsApp erreichbar sein zu können, halte ich nicht für erstrebenswert. Gleiches gilt für die Schüler: Die schlechte Unterrichtsvorbereitung des Lehrers per WhatsApp ausbaden zu müssen, weil der noch schnell seine Hausaufgaben hinterherschickt, kann auch nicht Sinn der Sache sein.
Man muss den Kindern doch den Umgang beibringen!
Meiner Erfahrung nach lernen Kinder den handelsüblichen Umgang mit WhatsApp ziemlich schnell: Texte zu schreiben, Videos zu schicken, Akronyme und Emojis zu verwenden, Bilder einzufügen, Gruppen anzulegen – ein Leichtes für herkömmliche 10-11-Jährige. Da ist keine besondere Herausforderung zu erkennen.
Weniger lehrreich ist es hingegen, wenn ach so medienreflektierte Lehrer die ihnen anvertrauten Kinder zu einem unreflektierten Umgang mit globalen Datenkraken wie Facebook nötigen. Wo, wenn nicht bei Schulkindern, könnte Facebook sein erstes großes Ziel, eine umfassende Abbildung der Soziostruktur seiner Nutzer zusammenzusammeln, am leichtesten erreichen? Die Kinder nutzen WhatsApp arglos – umso mehr, wenn auch der coole Lieblingslehrer / Schuldirektor das wie selbstverständlich im Unterricht benutzt. Reflektierter Umgang? Fehlanzeige! Wenn der Lehrer zum Gebrauch von WhatsApp einlädt, dann hilft am Ende auch keine wohlgemeinte superkritische Klassenleiterstunde mehr. Zumal das Kernproblem der WhatsApp-Nutzung bei jungen Menschen im Unterstufenalter ganz woanders liegt.
Mobbing
In der Altersgruppe der Zwölf- bis 19-Jährigen gibt jeder Dritte (34 %) an, dass in seinem Bekanntenkreis schon einmal jemand im Internet oder per Handy fertig gemacht wurde. […]
Setzt man die Schwelle der Beeinträchtigung etwas niedriger und unterstellt nicht explizit die Absicht, jemanden gezielt fertig zu machen, sondern fragt nach, ob über die befragte Person schon einmal beleidigende, falsche oder peinliche Sachen im Internet oder per Handy verbreitet wurden, so sieht sich jeder Fünfte als Betroffener. (JIM Studie 2016)
Und das ist der Kontext, in dem mir WhatsApp im Schulkontext überwiegend begegnet: Als Mobbing-Medium (und Nerv-Medium). Spricht man mit den SuS, so bemängeln diese, dass in Klassengruppen viel unnützes Zeug gepostet werde (300x „Hi“, ellenlange sinnlose Zeichenkombinationen, zeitfressende Sprachnachrichten, „lustige“ Bilder, etc.) und man phasenweise sein Handy stummschalten müsse, weil es unaufhörlich bimmelt. Fragt in euren Klassen doch einfach mal nach.
Noch ärger ist jedoch das Mobbing. Dieses hat es schon immer gegeben und es ist auch immer schon ein typisch schulisches Problem; die mittlerweile auch nicht mehr allzu frische Erkenntnis ist aber, dass Mobbing mit WhatsApp eine neue Qualität hinzugewonnen hat, denn das Mobben findet nun zeitlich und örtlich uneingeschränkt statt. War früher nach Schulschluss zunächst einmal phasenweise Ruhe vor den Mobbern, so können diese bis in den freien Nachmittag, bis ins Wochenende und sogar über die Ferienzeit ihr mieses Spiel weitertreiben. Und das tun sie auch. Fleißig und emsig.
„Aufklärung!“, rufen in solchen Fällen die Apologeten. Die Kinder müssten ja den Umgang mit modernen Medien noch lernen – und verweisen (auch im Twitter-Dialog) gerne auf eine Sammlung hohler Arbeitsblätter, die aber im Fall der Fälle nichts bewirken. Und auch so manche Eltern kümmern sich einen feuchten Kehricht um die WhatsApp-Nutzung ihrer Kinder, wenn man sieht, was diese so an Frivolem und Gewaltverherrlichendem über ihr Smartphone versenden. Nicht zuletzt wir Medienfuzzis schließen gerne die Augen vor diesen Problemen, denn sie passen so gar nicht in unsere schöne neue Medienwelt. Den Umgang lernen sollen sie, doch sind die meisten meiner Meinung nach noch viel zu jung dafür, um distanziert und souverän mit komplexen Kommunikationssituationen, wie sie sich auf WhatsApp darstellen, umzugehen. Wie auch, das Leben an sich ist in diesem Alter doch schon kompliziert genug.
Umbruchssituationen
Kommen Kinder an die weiterführende Schule, sind sie meist zwischen 10 und 12 Jahren alt, verlassen ihre vertraute Grundschulumgebung und treffen auf eine völlig neue Klasse, in der sie viele neue Lehrer und Mitschüler kennenlernen. Das geht nicht nahtlos vonstatten, sondern ist immer begleitet von Brüchen und Schmerzen: Die liebgewonnene junge Klassenlehrerin wird ersetzt durch einen grummeligen Oberstudienrat, die meisten guten Freunde gehen auf eine andere Schule und plötzlich hat man nur noch zwei bis drei bekannte Bezugspunkte in der Klasse, zum Glück ist die beste Freundin auch dabei. Dann kommt die Phase der Annäherung und Neuordnung – und plötzlich ist die beste Freundin jemand anderes beste Freundin. Neue Cliquen bilden sich, und was hier in zwei, drei Sätzen abgehandelt wird, ist in Wirklichkeit ein monatelanger, teils jahrelanger, Prozess, der oft mit extremen Höhen und Tiefen, Freude, Hoffnung und Enttäuschung verbunden ist.
In diesen Situationen ist WhatsApp Gift fürs Klassenklima. Kinder, die mit den vielfachen Herausforderungen der schriftlichen Kommunikation heillos überfordert sind, treffen dann auf eine komplexe Klassensituation, die sie selbst gar nicht einordnen können. Als Kind will man einfach nur dazugehören. Das zeigt sich in WhatsApp-Gruppen, die von nutzlosen und in die hunderte gehenden „me too“-Beiträgen nur so wimmeln, und in denen der Enttäuschung über alte oder neue (Nicht-)Freunde lautstark oder auch subtil Luft gemacht wird, flankiert von weiteren Anheizer-WhatsApp-Gruppen, die sich zusätzlich noch strategisch drumherum gebildet haben. Und das kann übel enden – die Ratgeberliteratur ist mannigfaltig, ein Gespräch mit dem zuständigen Schulpsychologen erhellend.
Es ist natürlich schön, wenn die Kinder miteinander den richtigen Umgang mit Messenger-Apps wie WhatsApp lernen, aber reichlich zynisch aus der Perspektive eines betroffenen Kindes, das täglich die „Lernversuche“ der anderen ertragen und dabei selbst erlernen muss, dass es jederzeit und an jedem Ort das Opfer seiner Mobber sein muss.
Kein Messenger, nie?
Auch ich finde Messenger großartig, nutze sie oft und gerne. Am liebsten solche, die nicht mein Adressbuch filzen und ohne meine Handynummer auskommen. Am liebsten Ende-zu-Ende verschlüsselt. Am liebsten nicht in den Händen großer Datensammler, gerne auch gegen Geld. In Schule kann ich mir Messenger als große Bereicherung vorstellen: Als konkreten Schulmessenger mit klaren Regeln, klar definierten Gruppen, und je älter und reifer die Kinder werden, umso offener kann man den Umgang damit gestalten. Natürlich ändert das nichts an all den Problemen, die über private Messenger wie WhatsApp entstehen, jedoch ist dann niemand gezwungen, diese schulisch zu nutzen.
Denn am Ende ist der tollste Unterrichtseinstieg per WhatsApp nichts wert, wenn Kinder seelisch zu Schaden kommen.