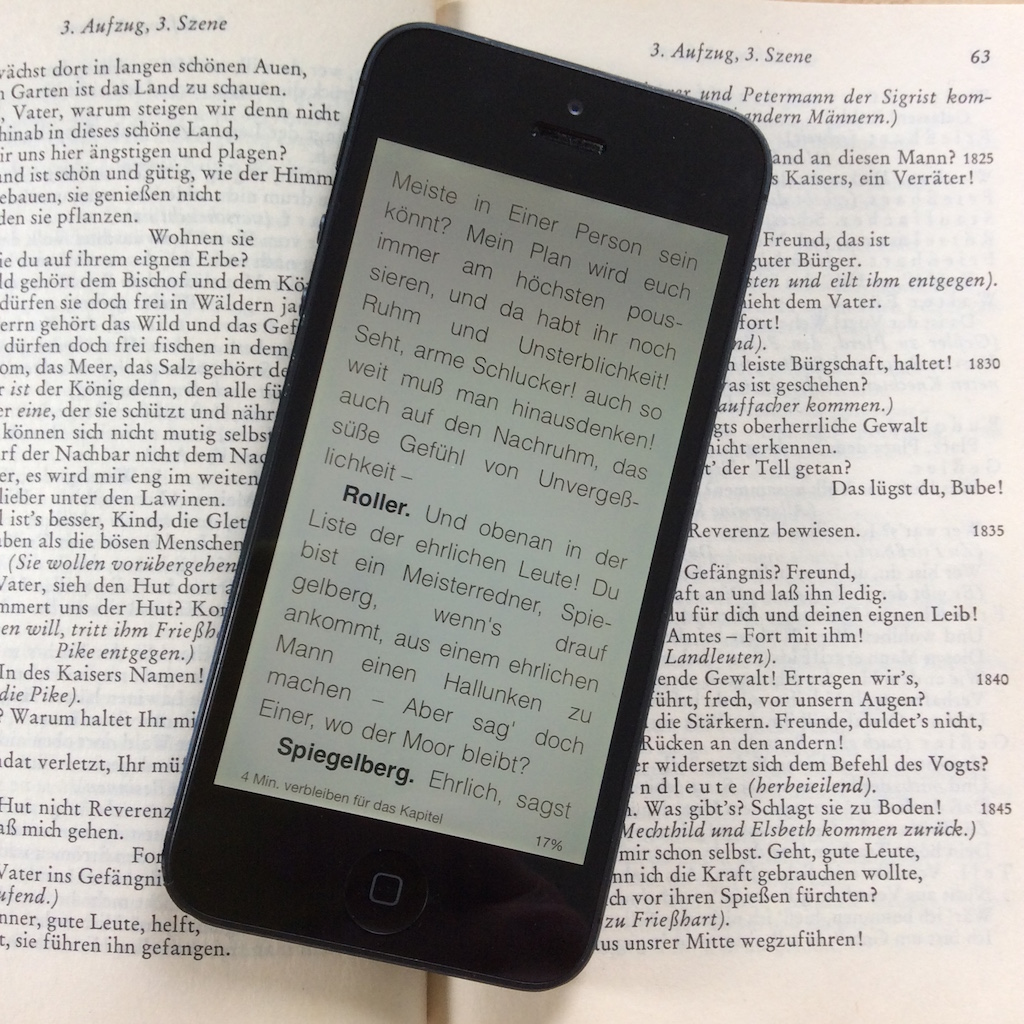Ein Impulsvortrag. Eine junge Kollegin einer benachbarten Schule steht in der Aula vor dem Kollegium und beschwört die Segnungen des selbstgesteuerten Lernens. Man erstelle einfach ein paar Lernpakete mit Checklisten zur Selbstkontrolle und dann könnten die Schüler einfach loslegen. Das Ausarbeiten der Pakete – nun ja – das habe schon einiges an Zeit und Mühe gekostet, aber wenn diese einmal fertig seien, dann könne man sie ja immer nutzen und müsse nur noch anpassen. (Heute bin ich mir sicher, dass das der Traum aller Lehrer ist. Immer. Unerfüllbar.) Die Schüler könnten dann eigenständig, im eigenen Tempo lernen, sich selbst kontrollieren und der Lehrer als Coach begleitend aktiv werden.
Ich kann mich erinnern, durchaus beschwingt und motiviert aus dem Vortrag herausgegangen zu sein. Loslegen! Anpacken! Jetzt sofort. Und wäre das nicht alles noch viel toller, wenn man das Ganze mit Hilfe des Computers gestalten könnte?
Digitale Selbststeuerung
Jörg Dräger, Autor des Bandes „Die digitale Bildungsrevolution“ und Mitarbeiter der Bertelsmann-Stiftung, hat genau diese Lösung vor Augen. Er berichtet in einem Interview im SWR Aula-Podcast „Lernen im Netzwerk – Die Bildung und die digitalen Medien“ von Algorithmen, mit deren Hilfe Schülerinnen und Schüler in Zukunft (und gewiss unterstützt von tollen Programmen der Bertelsmann-AG) lernen sollen. Die Schüler bekommen ihre Aufgaben digital zugewiesen und ein Computerprogramm berechnet nach Beendigung der Übung, welche Fehler besonders geübt werden müssen:
Die Schüler kommen morgens in die Schule und sehen auf dem Bildschirm: „Aha, ich muss an Station 7 noch Bruchrechnen wiederholen.“ Während andere Schüler der Klasse schon viel weiter sind und an ganz anderen Lektionen arbeiten. Lehrer werden ihre Lernbegleiter. Es findet eher Arbeit in Gruppen oder einzeln statt als im gesamten Klassenverband. Da ist wirklich die gesamte Pädagogik verändert. Digitalisierung ist ein ganz wichtiges Hilfsmittel, weil die Kinder mit Lernsoftware oder Videos arbeiten. Sie können sich z.B. ein Erklärvideo angucken, wenn sie etwas nicht verstanden haben, ohne sich wegen Rückfragen im Unterricht blamieren zu müssen. Und sie haben eben einen Algorithmus, der ein individuelles Curriculum für jeden berechnet.
Klingt aus dem Mund Drägers ganz großartig und die Rationalisierung von Lehrerstellen ist inbegriffen, denn irgendwie muss das teure Zeug (Hardware, Lizenzgebühren für die Software) ja finanziert werden:
In der New Yorker Schule, die wir besucht haben, sind 90 Kinder in einem Klassenzimmer. Aber die sitzen natürlich nicht alle hintereinander und gucken auf eine Tafel, sondern sie sitzen an runden Tischen oder in kleinen Einzelboxen und arbeiten entweder miteinander oder für sich. Die Lehrer laufen herum und helfen dort, wo ihre persönliche Hilfe dringlich ist.
Großraumbüroatmosphäre. Von Kreativität, vom Gestalten, wie zu Beginn des Interviews, ist übrigens keine Rede mehr. Erklärvideos. Den Nürnberger Trichter füllen. Nix Diskussion, Debatte, Austausch, Vertiefung. Wie auch? Debatte über moralisch-ethische Fragen mit Siri führen? Okay, Google?
Um den Begriff des „selbstgesteuerten Lernens“, der sich anhand der Beschreibung des Verhaltens der Schüler der New Yorker Schule aufdrängt, drückt sich Dräger auf Nachfrage des Interviewers herum, im Kern geht es aber genau darum:
Das Ziel ist schon, dem Schüler Lernen lernen beizubringen. […] Inzwischen geht es aber nicht mehr so sehr um Wissen wissen – das kann ich zur Not auch im Internet nachgucken –, sondern es geht mehr darum, eine Lernmethodik zu haben, mit der ich mir Neues beibringen kann, […]. Und wenn ich die Quizfrage nicht richtig beantworten kann, dann sagt mir das Programm vielleicht, die letzten fünf Minuten des Videos zu wiederholen. […] Das Feedback gibt dem Schüler Auskunft über sein eigenes Lernverhalten, über seinen Wissensstand, der Schüler überschätzt sich nicht, er unterschätzt sich nicht und wird so zu einem selbstverantwortlichen Lerner.
Das klingt schon etwas widersprüchlich, oder? Das Wissen der Welt liege im Netz, man brauche nicht mehr Wissen zu lernen, aber wehe, der Schüler kann die Quizfrage (!) nicht richtig beantworten? Und dann muss er das Video wiederholen, obwohl das ja nach der drägerschen Logik Unsinn ist, weil er das Wissen ja jederzeit im Video abrufen kann!? Crazy stuff, dieses neue Lernen. Und wer gestaltet eigentlich die Curricula, deren Inhalte ja niemand mehr zu lernen braucht, weil diese ja im Internet permanent abrufbar… ach, das ist aber auch kompliziert.
Wie auch immer. Folgt man Dräger soll erstens der Unterricht im Wesentlichen automatisiert gesteuert werden. Nötig sind dafür möglichst leicht abzufragende und messbare „Kompetenzen“, die man unkompliziert in „Quizfragen“ o. Ä. abfragen kann. Eine Vorstufe des Ganzen findet man ja schon in den Lernstandserhebungen in Klasse 8, wo das Leseverständnis über Multiple Choice-Abfragen ermittelt wird (Was der Schüler tatsächlich verstanden hat, wissen wir nach Auswertung der Tests auch nicht; wir wissen nur, ob er falsch oder richtig angekreuzt hat). Zweitens sollen die SuS sich anhand des ihnen computerisiert vermittelten Feedbacks in puncto Lernverhalten und Wissensstand einschätzen und ihr weiteres Lernen regulieren (lassen). Drittens: Wenn alles nichts mehr hilft, muss der leibhaftige Lehrer ran.
Man merkt, ich bin nicht überzeugt. Dass Dräger vor den SWR-Aula-Hörern den Begriff des selbstgesteuerten Lernens meidet, liegt zum einen darin begründet, dass er nicht verhehlen kann, dass die Steuerung des Lernens maßgeblich über den Schulcomputer funktioniert, zum anderen mag es seinen Grund aber auch im Podcast von Matthias Burchardt haben, der an gleicher Stelle genau eine Woche vor dem Interview Drägers publiziert wurde und der zu gänzlich gegensätzlichen Erkenntnissen kommt.
Eine Krise des selbstgesteuerten Lernens?
Im Podcast „Wir machen alles alleine. Die Krise des selbstgesteuerten Lernens“ (Link zum Script) zerpflückt Bildungsforscher Dr. Matthias Burchardt das Mantra des selbstgesteuerten Unterrichts.
Nun Lerner statt Kind
Burchardt kritisiert, dass sich die Befürworter des selbstständigen Lernens zwar der Begrifflichkeiten bedienen, die in Tradition der humanistischen und aufklärerischen Tradition stehen, diese aber nicht in einem aufklärerischen Sinne umsetzten. Darüber hinaus verweist er auf den neutralisierenden Begriff der „Lernerin“ und des „Lerners“, welcher die sozialen Beziehungen, die mitgedacht werden, wenn man von „Kindern“ oder „Schülern“ spricht, begrifflich beiseite schiebt:
Das Kind hat Eltern, der Schüler hat Lehrer, der Lerner hat Strategien und Probleme, die er im Austausch mit anderen optimal lösen soll.
Kybernetik statt Didaktik
Im Folgenden zeigt Burchardt eindrucksvoll, wie der selbstständige Lerner funktionieren soll:
Wenn nun der Lerner kein Kind und kein Schüler mehr sein darf, wie sieht dann sein Innenleben aus? Es ähnelt einer Schaltzentrale aus der Roboter-Technik. Schließlich soll er in der Lage sein, das (Zitat) eigene „Lernen [zu] regulieren, […] sich selbstständig Lernziele zu setzen, dem Inhalt und Ziel angemessene Techniken und Strategien auszuwählen und sie auch einzusetzen.“ (Höfer/Madelung 2006, 159). Die Lerner – heißt es weiter – „halten […] ihre Motivation aufrecht, bewerten die Zielerreichung während und nach Abschluss des Lernprozesses und korrigieren – wenn notwendig – die Lernstrategie.“ (ebd. 19).
Burchhardt führt aus, dass der oben zitierte Sprachgebrauch letztlich dem der Kybernetik entstammt und erläutert am Beispiel eines selbstregulierenden Heizungsthermostats, wie das Lernen der Zukunft zu funktionieren hat. Das Ergebnis ist erschreckend nah an dem, was uns Dräger als Zukunftsvision verheißen möchte:
Wie ein kleiner Lernroboter navigiert der selbstgesteuerte Lerner über die Klippen der Lernumgebungen, die ihm durch Lernpakete und Wochenpläne Aufgaben mit auf den Weg geben. Er steuert dabei die Ziele an, die im Raster vorgegeben sind. Er vergleicht Ist- und Soll-Werte seiner Kompetenzen, wählt und reflektiert seine Lernstrategien, bis er die Lernziele erreicht. Defizite in der Selbststeuerung sollen mittels Feedback in einem Coaching-Gespräch beseitigt werden.
Für Burchhardt stellt das Konzept des selbstständigen Lerners ein Konzept dar, das sich nicht damit auseinandersetzt, wie Kinder lernen, sondern welches beschreibt, wie man Kinder zu selbstgesteuerten Lernern umerzieht. Darüber hinaus beurteilt er es als ein „anti-humanistisches, im Wortsinne un-menschliches Modell, weil es vom Kind verlangt, sich wie eine kybernetische Maschine zu verhalten“. Die Mängel und Oberflächlichkeiten, die durch das technisierte Messen, Soll-Ist-Werteabgleich und das Feedback, im Gegensatz zu umfassender Urteilskraft, Auseinandersetzung, Kritik oder Würdigung, entstehen, sieht Burchhardt letztlich als Gefahr:
Wie deformierend müssen diese Modelle erst wirken, wenn Menschen danach geformt werden?
Schlechtes „Feedback“ für das kybernetische Lernen
Den theoretischen Schwächen des Konzeptes gesellen sich die praktischen hinzu. Burchhardt zählt auf, woran es mangelt, wenn Schulen versuchen, das Konzept des selbstgesteuerten Lernens praktisch umzusetzen:
- hohe Arbeitsbelastung, trotz zusätzlicher Ressourcen
- Leistungskontrollen nur noch anhand oberflächlicher Merkmale wie Vollständigkeit, Seitenzahl, Deckblattgestaltung, formaler Richtigkeit; wenig Beachtung der inhaltlichen Qualität
- Überforderung der Schülerinnen und Schüler
- hohes Maß an Unterrichtsstörung
Wirtschaftliche und politische Interessen am selbstregulierten Lernen
Burchhardt befürchtet, „dass es Unternehmen gibt, z.B. im Bereich der IT-Branche, die gut darauf vorbereitet sind, in die Lücke zu springen, die der degradierte Lehrer hinterlässt. Vermutlich wird man es als Entlastung empfinden, wenn die Lernpakete seitens der Verlage produziert und als Lernsoftware präsentiert werden. Unter dem Schlagwort „Digitalisierung des Lernens“ läuft derzeit eine umfangreiche PR-Kampagne für den Einsatz von Digitalen Geräten in Schulen.“ Und tatsächlich ist Schule ein Milliardenmarkt für die großen Unternehmen, und Lehrer werden unter diversen Labels zu „zertifizierten“ iPadMicrosoftGoogle-Lehrern „ausgebildet“ und dienen als Hubs in die doch eher konservative Lehrerschaft.
Und auch in der Politik sieht Burchhardt Interessenten an dem „Neuen Lernen“:
Die Aufforderung zur Selbststeuerung passt auf eine zynische Weise ideal zum Abbau der sozialen Solidaritäts- und Sicherungssysteme: So wie der Selbstgesteuerte Lerner schonend mit der Ressource Lehrer umgeht, so fällt der selbstgesteuerte Bürger der Gemeinschaft nicht zur Last: Die Themen seiner sozialen Absicherung, seiner Bildung, seiner Gesundheit sind allein sein Problem. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Armut sind dann Konsequenzen mangelhafter Selbststeuerung, die er selbst optimieren muss.
Der Impulsvortrag – wie würde ich ihn mir heute wünschen?
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …